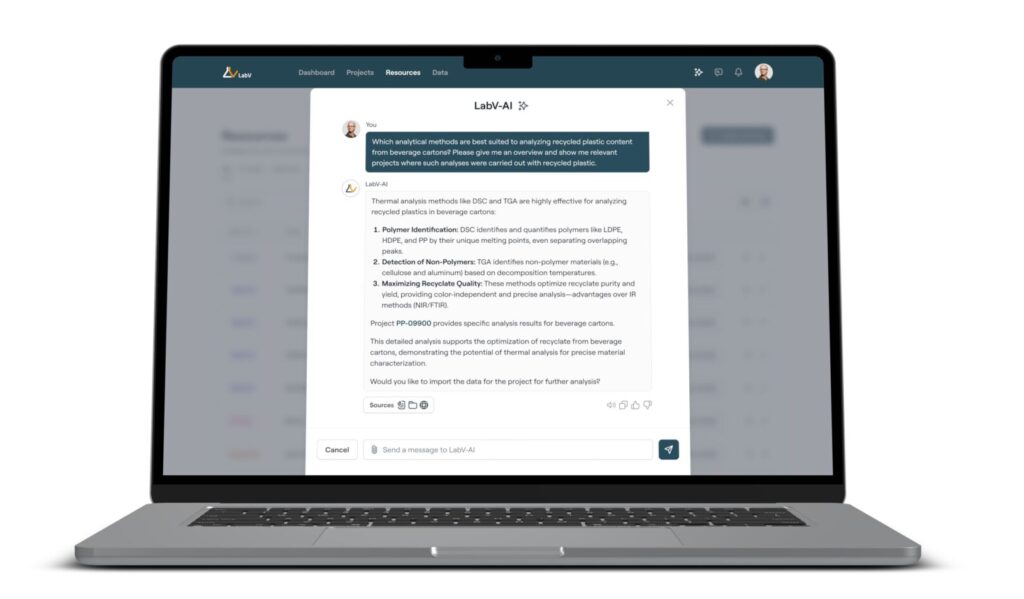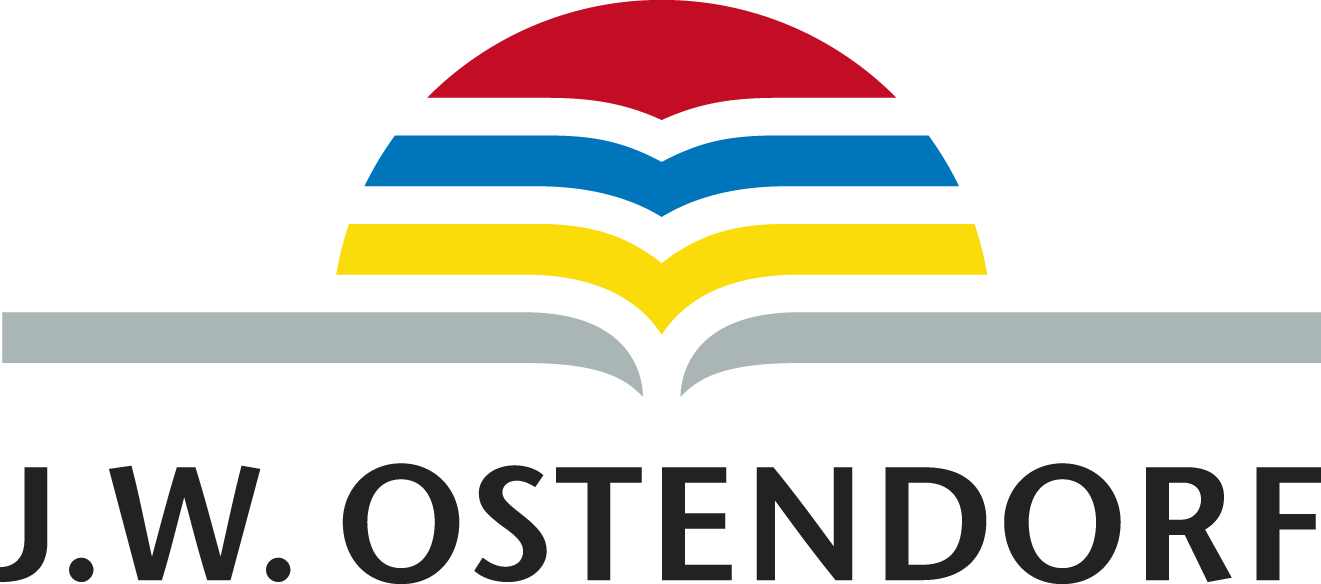Johannes Petzke, KI-Transfermanager bei KI.NRW, erklärt wie Unternehmen zielorientiert mit KI starten können
Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie – doch viele Unternehmen tun sich schwer mit dem Einstieg: Wo anfangen? Welche Prozesse eignen sich? Und wie komme ich vom ersten Gedanken zur konkreten Anwendung?
Genau hier setzt die Methodik AI.Shadowing an. Sie bietet Unternehmen einen strukturierten und zugleich praxisnahen Ansatz, um KI-Potenziale systematisch zu identifizieren – auch ohne technisches Vorwissen oder große IT-Abteilung. Mit gezielten Fragen, moderierten Gruppenprozessen und klaren Templates lassen sich erste Use Cases entwickeln, bewerten und weiterdenken.
Johannes Petzke, KI-Transfermanager bei KI.NRW, erklärt die AI.Shadowing-Methode, ihren Nutzen und ihre Wirkung.
Was genau ist die AI.Shadowing-Methodik?
Das AI.Shadowing zielt darauf ab, Unternehmen, die bisher noch wenig Berührungspunkte mit KI-Anwendungen haben, eine erste Orientierung zu KI-Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Unternehmensbereichen zu geben. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo KI wie helfen kann, ist ein wenig Grundwissen über dieses große und sehr dynamische Feld wichtig.
Der erste Baustein der Methodik ist deshalb ein kompakter Einstieg, der zentrale Begriffe einordnet, Funktionsweisen erklärt und schließlich zahlreiche Anwendungsbeispiele bereitstellt. Auf dieser Grundlage erfolgt ein umfangreiches Brainstorming von Ideen der Teilnehmenden zu Einsatzmöglichkeiten von KI. In Kleingruppen werden die Ideen erläutert, strukturiert, priorisiert und schließlich im Plenum vorgestellt. Die Top-Ideen werden daraufhin erneut in Kleingruppen zu Use Cases ausformuliert und hinsichtlich Wertstiftung und Machbarkeit bewertet.
Welche typischen Herausforderungen erleben Sie bei Unternehmen, wenn es darum geht, sinnvolle KI-Anwendungsfälle zu erkennen?
Häufig ist es für die Unternehmen schwer abschätzbar, welche KI-Anwendung für sie hilfreich ist und welche nicht. Aus diesem Grund verfolgt das AI.Shadowing den Ansatz, Ideen und damit auch Use Cases von bestehenden Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit aus zu denken. Dadurch versuchen wir zu verhindern, dass wertvolle und in der Regel knappe Ressourcen in KI-Anwendungen investiert werden, die sehr umfangreiche Möglichkeiten mitbringen, aber bei konkreten Herausforderungen kaum helfen oder im Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht überzeugen.
Wir nehmen außerdem nach wie vor ein sehr heterogenes KI-Grundwissen in den Unternehmen wahr. Aus Unsicherheit kann Ablehnung resultieren. KI ist jedoch ein Teamsport. Klare Verantwortlichkeiten und Sub-Teams, die sich verstärkt mit Anwendungsmöglichkeiten auseinandersetzen, sind sinnvoll und wichtig. Für die flächendeckende Erkundung von Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmen ist das Fachwissen aller Mitarbeitenden jedoch sehr wertvoll und hilfreich.
Wie hilft AI.Shadowing dabei, aus ersten Ideen tatsächlich umsetzbare Use Cases zu machen?
Durch die vorbereiteten Leitfragen sowohl im Brainstorming als auch bei der Entwicklung der Use Cases werden von vornherein wichtige Punkte mitgedacht, die einen strukturierten Weg von einer Idee hin zu einem Use Case ermöglichen. Welches konkrete Problem wird adressiert? Wie äußert sich dieses Problem? Was sind aktuell die Konsequenzen? Welche Fähigkeiten muss eine KI-Lösung haben, damit ein klarer Nutzen entsteht? Welches konkrete Ziel verfolge ich mit dieser Anwendung? Welche Daten liegen vor? Welche Risiken gibt es? Dies ist nur ein Ausschnitt an Fragen, die wir uns in der Erstellung jedes Use Cases stellen.
Was unterscheidet die Methodik von klassischen Innovationsworkshops oder Ideensammlungen?
Das Shadowing bietet einen sehr strukturierten, fach- und branchenübergreifenden Ansatz, innerhalb kurzer Zeit von ersten Ideen hin zu vergleichbaren Use Cases zu kommen. Eines unserer Anliegen ist es, den Mitarbeitenden die Methodik so zu vermitteln, dass sie diese im Anschluss auch ohne unser Mitwirken immer wieder einsetzen und neue Use Cases erarbeiten können.
Welche Rolle spielt dabei die Gruppendynamik – also das gemeinsame Arbeiten und Diskutieren?
Die Gruppendynamik spielt eine sehr entscheidende Rolle, denn jede/r Mitarbeiter/in bringt eine einzigartige Perspektive für einen Prozess oder ein Produkt mit. Diese Perspektive kann in einzigartigen Ideen für KI-Anwendungsmöglichkeiten resultieren. So bekommen die Teilnehmenden häufig ein besseres Gefühl für die Herausforderungen der jeweils anderen Person und nicht selten kommt es alleine durch den Austausch in der Gruppe zu sehr spannenden Impulsen für die weitere Arbeit.
Wie können Unternehmen nach einem Shadowing-Prozess weiterarbeiten, um ihre Ideen in echte Projekte zu überführen?
Insbesondere, wenn Unternehmen noch keine Erfahrung bei der Umsetzung von KI-Projekten haben, empfehlen wir, sich zunächst auf möglichst pragmatisch umsetzbare Use Cases zu fokussieren. Dies ermöglicht vergleichsweise schnell Erfahrungen in der Umsetzung zu sammeln, die wertvoll für nachfolgende Projekte sind. Zudem sollten klare Verantwortlichkeiten in Form von einer oder mehrerer Personen vorhanden sein, die sich primär um die Umsetzung kümmern. Sollte die Umsetzung mit einem externen Partner erfolgen, können sich Unternehmen auf der KI.Landkarte von KI.NRW nach passenden Anbietern aus NRW umschauen. Hier besteht auch die Möglichkeit nach Branche, KI-Schwerpunkten und sonstigen Faktoren zu filtern.
Und zum Schluss: Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, sich als Unternehmen mit KI auseinanderzusetzen – besonders im Mittelstand?
Die klare Antwort hier ist: je früher desto besser. Immer mehr Unternehmen setzen branchenübergreifend auf KI-Anwendungen. Die Gründe sind vielfältig: Effizienzsteigerung, Ausgleich des Fachkräftemangels durch Automatisierung, steigende Anforderungen und Erwartungen seitens der Kunden oder schlichtweg die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Als Mittelständler ist es daher wichtig, den Einsatz von KI als Chance zu sehen, und die Einsatzmöglichkeiten zu erkunden.